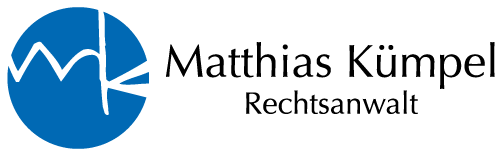Das Landgericht Münster hatte einen interessanten Fall aus dem Bereich der Arzthaftung zu entscheiden (LG Münster 01.03.2018, Az.:111 O 25/14). Ein Klinikträger wurde verurteilt ein beachtliches Schmerzensgeld von 250.000,- Euro nebst Zinsen zu zahlen sowie für sämtliche resultierenden materiellen Schäden sowie künftige immaterielle Schäden aufgrund der fehlerhaften Behandlung und unzureichenden Risikoaufklärung durch einen externen Belegarzt zu haften.
Schmerzensgeld wegen fehlerhafter Bandscheibenoperation
Die zum Behandlungszeitpunkt 55 Jahre alte Klägerin begehrt Schmerzensgeld und die Feststellung der weitergehenden Ersatzpflicht im Zusammenhang mit einer Bandscheibenoperation vom 04.02.2011, die ein mittlerweile verstorbene Belegarzt im Krankenhaus des Klinikträgers durchgeführt hat.
Die Klägerin litt seit dem Jahr 2003 an Kopfschmerzen, Nackenschmerzen mit Ausstrahlung in den Hinterkopf, sowie an Armschmerzen bis in den Oberarm bzw. in die Schulter hinein (Zerviko-Zephalgien). Zeitweilig bestanden auch Schmerzen im Bereich der Oberarmaußenseite sowie Parästhesien im Bereich der Finger eins und zwei der rechten Hand und im Bereich beider Füße. Sie wurde von ihrem Hausarzt im November 2009 an ein Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie überwiesen. Dort wurde nach der Erhebung von MRT-Befunden zur Überprüfung der unklaren Parästhesien zunächst eine elektrophysiologische Abklärung empfohlen.
Fehlende Indikation für den neurochirurgischen Eingriff
Da die Beschwerden weiter fortbestanden, stellte sich die Klägerin im Januar 2011 bei dem Belegarzt vor. Es erfolgte die Anfertigung weiterer MRT-Aufnahmen. Der Arzt diagnostizierte einen Bandscheibenvorfall C5/6 und C6/7 mit rechtsbetonten beidseitigen Zerviko-Brachialgien. Er stellte die Indikation für eine Operation der Bandscheibe in den Segmenten C5/6 und C6/7 und befürwortete den Eingriff, wobei streitig ist, mit welchem Nachdruck dies geschah. Die stationäre Aufnahme in der beklagten Klinik fand am 03.02.2011 statt. An diesem Tag unterzeichnete die Klägerin eine „Dokumentation des Aufklärungsgesprächs des Patienten mit dem Arzt“. Wegen des Inhalts der Dokumentation wird auf die Krankenunterlagen verwiesen.
Der Eingriff wurde am 04.02.2011 durchgeführt. Unstreitig kam es hierbei zu einer Verletzung des Rückenmarks. Nach Abklingen der Narkose war die Klägerin nicht mehr in der Lage, sich zu bewegen. Die Klägerin wurde in der Nacht vom 04. auf den 05.02.2011 in das Universitätsklinikum verlegt, wo anhand einer MRT-Aufnahme eine odamentöse Auftreibung des Rückenmarks in Höhe HWK 6/7 mit begleitender Einblutung als Nachweis einer intraoperativen Rückenmarksverletzung diagnostiziert wurde. Außerdem wurde eine Kehlkopfverletzung festgestellt.
Operation trotz Kenntnis des Klinikträgers von der Alkoholabhängigkeit des Belegarztes
Unstreitig litt der Belegarzt an einer Alkoholabhängigkeit, wobei streitig ist, ob und in welcher Form diese zum Eingriffszeitpunkt bestanden hat. In dem Zeitraum, in dem ein Belegarztvertrag mit dem Klinikträger bestanden hat, befand sich der Belegarzt wegen der Alkoholproblematik zwei Mal in stationärer Behandlung. Ein mehrwöchiger Aufenthalt in einer Klinik fand bereits im Jahr 2008 statt. Ferner wurde der Arzt dort vom 16.07. bis 31.07.2009 stationär behandelt.
Die Klinikträgerin kündigte zum 31.03.2011 ordentlich die mit dem Arzt bestehenden belegärztlichen Verträge (Belegarztvertrag, Mietvertrag, Kooperationsvertrag). Grund hierfür waren u.a. im Hause kursierende Gerüchte über den Alkoholkonsum und berichtete Auffälligkeiten. Mit Datum vom 08.02.2011 wurde von der Klinikträgerin gegenüber dem Belegarzt dann eine fristlose Kündigung der Vertragsverhältnisses ausgesprochen, nachdem dieser am 07.02.2011 alkoholisiert zur Durchführung einer Therapie in der Klinik erschienen war.
Der beklagte Klinikträger haftet neben den Erben des verstorbenen Belegarztes gesamtschuldnerisch auf Schmerzensgeld und Schadenersatz, weil dieser dem Arzt die Infrastruktur der Klinik für neurochirurgische Eingriffe zur Verfügung gestellt hat, obwohl sie schon weit vor der Operation der Klägerin wusste, jedenfalls aber hätte wissen müssen, dass der gesundheitliche Zustand des Belegarztes eine solche Tätigkeit nicht zuließ.
Fehlerhafte Risikoaufklärung
Die von der Klägerin erhobene Aufklärungsrüge führt zum Erfolg. Es konnte nicht bewiesen werden, dass überhaupt eine korrekte Aufklärung stattfand. Die Aufklärung war jedenfalls im Hinblick auf die relative Indikation unzureichend. Die von der Klägerin vor dem streitgegenständlichen Eingriff bestehenden Beschwerden, wie Nacken-, Kopf- und Armschmerzen stellten in erster Linie degenerativ bedingte Verschleißveränderungen dar. Eine solche Operation bringt bei dem vorliegenden Beschwerdebild überhaupt keinen Nutzen bringt. Die aus den radiologischen Befunden ersichtlichen Protrusionen, begründen keine Operationsindikation. Sie stellen bei Menschen ab einem Alter von circa Mitte 30 normale Erscheinungen dar. Ein Anlass, solche Protrusionen präventiv zu behandeln, bestand nicht. Brachialgien, welche eine relative Operationsindikation begründet hätten, bestanden bei der Klägerin nicht. Ausgehend von dem Beschwerdebild der Klägerin hätten ihr bei fachgerechtem Vorgehen primär eine fortgesetzte konservative Behandlung und eine Schmerztherapie empfohlen werden müssen.
Die Dokumentation der Aufklärung begründet kein Indiz für eine vollständige Aufklärung. Zwar kann dem Aufklärungsdokument entnommen werden, dass der Belegarzt handschriftlich als alternative Behandlungsmöglichkeit „kons. Therapie“ eingetragen hat. Dass ihr eine solche als ernsthafte Möglichkeit in einem mündlichen Aufklärungsgespräch tatsächlich aufgezeigt worden ist, blieb zweifelhaft.
Die Klägerin schilderte glaubhaft, ihr sei die Operation als dringlich und alternativlos beschrieben worden. In dem Aufklärungsbogen ist weiter maschinenschriftlich vermerkt: „Wenn mit der Operation zu lange gewartet werden sollte, muß mit folgenden Folgen gerechnet werden: Lähmungen, Gefühlsstörungen, Blasen-Mastdarm-Störungen, Schmerzen, Querschnittsyndroms“. Dieser Hinweis ist eindeutig fehlerhaft. Die genannten Folgen drohten für den Fall, dass die Operation nicht durchgeführt worden wäre, nach den überzeugenden mündlichen Ausführungen des Sachverständigen gerade nicht. Sie sind nun nicht deshalb eingetreten, weil die Klägerin den Eingriff unterlassen, sondern weil sie ihn hat durchführen lassen.
Der erhobene Einwand der hypothetischen Einwilligung, also die Behauptung, dass die Klägerin sowieso auch in den operativen Eingriff eingewilligt hätte, wenn sie korrekt über alle Risiken aufgeklärt worden wäre, greift nach der Entscheidung des Gerichts nicht durch. Die Klägerin schilderte glaubhaft, dass sie sich in einem Entscheidungskonflikt befunden hätte, wenn sie über die mangelnde Dringlichkeit und fraglichen Erfolgschancen des Eingriffs zutreffend informiert worden wäre.
Schlimme Folge des Eingriffs: Teilschädigung des Rückenmarks
Durch die Operation ist eine einseitige betonte Teilschädigung des Rückenmarks eingetreten. Seit dem Eingriff ist die Klägerin weitestgehend auf die Benutzung eines Rollstuhls angewiesen. Es besteht eine Blasen- und Mastdarminkontinenz. Der Rumpf ist taub, ebenso das linke Bein, auf der rechten Körperseite bestehen Schmerzen. Rechts besteht eine Fußheberschwäche. Aufgrund von Spastiken im rechten Arm und im rechten Bein erhält die Kläger seit Jahren vierteljährlich Botox-Spritzen. Die rechte Hand ist gelähmt. Die Klägerin ist körperlich schwach und nicht in der Lage, selbständig aus dem Bett zu kommen und sich zu waschen. Sie unterliegt der Pflegestufe II. Ihre Stimme ist geschädigt. Es besteht die Notwendigkeit regelmäßiger Ergotherapie. Es bestehen erheblich psychische Folgen.
Die genannten körperlichen Beeinträchtigungen sowie die Verletzung des Aryknorpels sind nach der Überzeugung des Gerichts ursächlich durch die Operation verursacht worden sind. Es könne dann nach dem Senat dahingestellt bleiben, ob insofern ein anästhesiologischer oder neurochirurgischer Behandlungsfehler unterlaufen ist und/oder diesbezüglich ebenfalls ein Aufklärungsdefizit vorliegt.
Unter Berücksichtigung dieser gesundheitlichen Beeinträchtigungen hielt das Landgericht ein Schmerzensgeld in Höhe von 250.000,- € für ausreichend, aber auch für angemessen. Dabei ist in die Bewertung eingeflossen, dass die Klägerin schon vor der streitgegenständlichen Behandlung nicht unerhebliche Beschwerden wegen des Grundleidens hatte. Die eingetretenen Folgen gehen aber weit über das vorbestehende Maß hinaus. Die Klägerin ist nunmehr zu einer selbständigen Lebensführung praktisch nicht mehr in der Lage. In ihrer Mobilität ist sie weitestgehend eingeschränkt und reduziert auf den Einsatz des Rollstuhls. Hinzu kommen Schmerzen und die mit der umfassenden Inkontinenz verbundenen Schwierigkeiten. Eine Besserung des Zustands ist nicht zu erwarten. Die Klägerin wird den Rest ihres Lebens an den vorgenannten Folgen leiden.
Da der Neurochirurg im Krankenhaus der Klinikträgerin unstreitig als Belegarzt tätig war, würde diese grundsätzlich nicht unmittelbar selbst für diesem vorwerfbare Aufklärungsversäumnisse oder Behandlungsfehler haften, wenn der Belegarzt bezüglich der von ihm erbrachten Leistungen einen eigenständigen Vertrag mit der Klägerin vereinbart hätte. Die Verantwortungsbereiche bei einem solchen gespaltenen Krankenhausaufnahmevertrag sind getrennt: Der Belegarzt ist allein zur Erbringung der ärztlichen Leistungen im eigenen Fachgebiet verpflichtet und haftet hierfür alleinverantwortlich. Das Belegkrankenhaus schuldet grundsätzlich nur die nicht ärztlichen bzw. ergänzenden ärztlichen Versorgungsleistungen (Anästhesie) und pflegerischen Dienste.
Der Krankenhausträger ist zu einer sachgerechten Organisation, Koordination und Überwachung der Behandlungsabläufe verpflichtet.
Dennoch geht das Gericht von einem direkten vertraglicher und deliktischer Anspruch gegen die Klinikträgerin wegen eigenen (Organisations-)Verschuldens aus. Der Krankenhausträger ist zu einer sachgerechten Organisation, Koordination und Überwachung der Behandlungsabläufe verpflichtet. Wird durch einen Verstoß gegen diese weit ausgelegte Pflicht bei einem Patienten ein Schaden verursacht, kommt eine Haftung unter dem Gesichtspunkt des Organisationsverschuldens in Betracht
Für die Klinikträgerin bestand als Nebenpflicht aus dem Krankenhausaufnahmevertrag die Verpflichtung auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen der klagenden Patientin Rücksicht zu nehmen. Sie hatte sich grundsätzlich so zu verhalten, dass insbesondere Körper und Leben der Klägerin nicht verletzt werden. Demgemäß durfte die Klinikträgerin grundsätzlich keine belegärztliche Tätigkeit in ihrem Krankenhaus ermöglichen, von der sie aufgrund eigener Erkenntnisse annehmen musste, dass sich diese schädigend für Patienten auswirken könnte. Hieran gemessen hat die Klinikträgerin ihre der Klägerin gegenüber bestehenden Schutzpflichten (grob) fahrlässig verletzt. Ihr ist ein eklatantes Organisationsverschulden anzulasten.
Aufgrund jahrelanger Kooperation hatte die Klinikträgerin Einblicke in die Tätigkeit des Belegarztes. Man hätte aufgrund der schweren Alkoholproblematik und konkreter Auffälligkeiten Zweifel haben müssen, ob der Arzt die für einen praktisch tätigen Neurochirurgen erforderliche Eignung noch besitzt. Man hätte die Zusammenarbeit mit dem Belegarzt mit sofortiger Wirkung zum Wohle der bei ihr aufgenommenen Patienten beenden müssen. Es handelt sich um eine mindestens grob fahrlässigen Pflichtverletzung.
Die Klinikträgerin gestattete dem Arzt nach der mehrwöchigen Entzugsbehandlung, seine belegärztliche Tätigkeit als Neurochirurg in der Klinik fortzusetzen. Angesichts der Gefahren, die von einem alkoholkranken, operativ tätigen Neurochirurgen für Patienten offenkundig ausgehen, hätte diese Entscheidung insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Arzt immerhin während einer Operation unter Alkoholeinfluss auffällig geworden war, schon nicht getroffen werden dürfen.Die Klinikträgerin handelte durch ihren Geschäftsführer schuldhaft. Dessen Verhalten ist gemäß § 31 BGB analog der Klinikträgerin zurechenbar. Die im Verkehr erforderliche Sorgfalt ist in besonders schwerwiegendem Maß verletzt worden.
Die Klinikträgerin hätte die Zusammenarbeit mit dem Belegarzt wiederum sofort nach Kenntnis der alkohol- und abhängigkeitsbedingten Auffälligkeiten außerordentlich beenden müssen.
Bei pflichtgemäßem Handeln der Klinikträgerin hätte der Arzt am zum Behandlungszeitpunkt der Klägerin schon längst nicht mehr tätig sein dürfen. Der Eingriff hätte dann so nicht stattgefunden. Die mit der Operation verbundenen Folgen wären nicht eingetreten. Das Gericht war davon überzeugt, dass diese Folgen auf dem streitgegenständlichen Eingriff beruhen. Der Feststellungsantrag hinsichtlich der zukünftigen Schäden war begründet, da damit zu rechnen sei, dass bei der Klägerin weitere materielle und auch derzeit noch nicht vorhersehbare immaterielle Schäden eintreten werden.