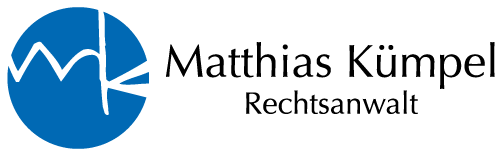Erläuterung und Kommentar: Rechtsanwalt Matthias Kümpel
Die neuen Fallzahlen zu Arzthaftung und Behandlungsfehlern für das Jahr 2018 wurden durch die Bundesärztekammer vorgestellt.
Geringer Rückgang der Fälle
Im Vergleich zum Vorjahr ist ein geringer Rückgang zu verzeichnen, was die Anzahl der gestellten Anträge 10.839 (Vorjahr 2017: 11.100) – 2,35 %, der Anzahl der erledigten Anträge 9.901 (Vorjahr 2017: 11.449) – 13,52 % sowie die Anzahl aller Sachentscheidungen (z. B. gutachterliche Bescheide) 5.972 (Vorjahr 2017: 7.307) – 18,27 % betrifft. Woraus diese leichte Veränderung resultiert, lässt sich nicht genau sagen.
Es ist aber nach dem Eindruck des Verfassers auch so, dass ohnehin nur eine geringe Anzahl der Fälle tatsächlich zu einem Schlichtungsverfahren gelangt und eine hohe Dunkelziffer an medizinischen Behandlungsfehlern anzunehmen ist, die niemals bei den Schlichtungsstellen noch bei den Krankenkassen oder Gerichten auftauchen.
Informationsdefizit der Patienten als medizinischen Laien
Die Patienten wissen als medizinische Laien, trotz einer wegen des Internets deutlich besseren Informationslage, häufig schlicht zu wenig über Indikationsstellung, Befunderhebung, Diagnostik, Aufklärung und (operative) Behandlung sowie Nachsorge. Der hierbei jeweils zu beachtenden Facharztstandard ist dem Patienten oft unbekannt und unverständlich, so dass Fehler unerkannt bleiben und vom Patienten als schicksalhaft und krankheitsbedingt betrachtet werden, obwohl vielleicht tatsächlich bei genauerer medizinischer und medizinrechtlicher Überprüfung ein relevanter Fehler passiert ist.
Diese strukturelle Unterlegenheit der Patienten- gegenüber der Ärzteseite gilt es so weit als möglich anzugleichen. Das Patientenrechtegesetz welches bereits im Februar 2013 in Kraft trat, hat die bestehende Rechtsprechung in Gesetzesform gebracht, aber hat darüber hinaus nicht viel am grundsätzlichen System des Arzthaftungsrechts insbesondere im Hinblick auf die komplizierten Fragen der Beweislast und der häufig schwammigen Differenzierung zwischen „einfachem und groben Behandlungsfehlers“ geändert. Wünschenswert wäre auch der erleichterte Zugang zu qualifiziertem medizinischen Sachverstand und Gutachtern, welcher dem Patienten, aus wirtschaftlichen Gründen oftmals verbaut ist.
Dokumentation und Informationspflichten
Bedeutsam sind Informationspflichten und eine sichere und möglichst irreversible und manipulationsfreie EDV-gestützte Dokumentation aller ärztlichen Schritte am Patienten besonders auch im ambulanten Bereich. Hierdurch schafft man Transparenz, wodurch das Vertrauen in die Ärzteschaft und die Kliniken gestärkt würde. Manches ist hier schon gesetzlich geregelt oder auf den Weg gebracht.
Doch wie soll der Arzt den Anforderungen der umfassenden Dokumentation nachkommen, wenn neben den Behandlungsabläufen kaum Zeit für ein vertiefendes Gespräch mit den häufig multimorbiden Patienten mehr bleibt. Die im Medizinsektor tätigen Ärzte und Chefärzte sollen Umsatz für die Kliniken generieren und werden vom Management betriebswirtschaftlich danach beurteilt und bewertet, ob dies ausreichend gelingt.
Wünschenswert: Förderung der sprechenden Medizin
Die gute und auch menschlich einfühlsame Arbeit des Arztes aber auch des Pflegepersonals, im Sinne der „sprechenden Medizin“ am Patienten, ist im stationären Bereich außerordentlich wichtig, bringt aber im gegenwärtigen System der Fallpauschalen ökonomisch kaum mehr Umsatz für die Kliniken. Folglich geschieht, wenn überhaupt etwas, nur das Nötigste und man beschränkt sich nur noch auf die praktische Durchführung der Behandlung.
Vorrang wirtschaftlicher Ziele vor dem Wohl der Patienten
Die Privatisierung staatlicher Kliniken ist politisch betrachtet, ein alsbald zu revidierender Irrweg. Kliniken und die tätigen Leistungserbringer haben die Kernaufgabe für die Gesundheit der Bürger zu sorgen und wesentlich das Wohl der Patienten und nicht Umsatz und Gewinn im Auge zu haben.Die ökonomische Seite der Medaille ist sicher wichtig und relevant, aber im Hinblick auf des eigentliche Primärziel die Patienten angemessen nach Facharztstandard zu behandeln und zu heilen, eben erst in zweiter Linie.
Gegenwärtig ist die Situation meiner Meinung nach umgekehrt. Politisch gewollte, ökonomische Vorgaben haben das Gesundheitswesen fest im Würgegriff. Hier darf sich der Staat im Bereich der Daseinsvorsorge nicht weiter zurückziehen und durch immer mehr Privatisierung bzw. durch Schließung von „unwirtschaftlichen“ Kliniken die Medizin in diesem Land immer mehr dem freien Spiel des Marktes überlassen. Dies hätte fatale Folgen für uns alle.
Letztlich ist als wesentliche Ursache für Fehler und Missstände im stationären medizinischen Bereich der massive wirtschaftliche Druck der auf das Gesundheitssystem einwirkt zu benennen. Dieser führt zur systematischen und letztlich politisch gewollten Überlastung des Kliniksektors und der dort ärztlich und pflegerisch tätigen Menschen.
Doch nun kommen wir wieder zu den Zahlen der Statistik:
Die 10 häufigsten Diagnosen im Rahmen von ärztlichen Behandlungsfehlern oder Risikoaufklärungsmängeln mit denen die Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen im Jahr 2018 befasst waren lauten:
Degenerative Gelenkerkrankungen des Kniegelenks (Gonarthrose), Arthrose des Hüftgelenks (Koxarthrose), Oberschenkelbruch (Femurfraktur), Schaden der Bandscheibe, Lendenwirbelsäule Unterschenkel- u. Sprunggelenksbruch, Knie (degenerativ) Unterarmbruch, Schleimbeutelentzündung der Schulter (Bursitis), Knie Binnenschaden (traumatisch), Schulter- und Oberarmbruch.
Die Vorwürfe der Patienten betrafen wesentlich die Durchführung der operativen Therapie, die Diagnostik bei bildgebenden Verfahren (Röntgen, MRT, CT u.a.), Anamnese/ Untersuchung, Indikation, Aufklärung über das Risiko, Maßnahmen der postoperativen Therapie, Behandlung durch Arzneimittel, Labordiagnostik/ Zusatzuntersuchungen, konservative Therapie und Infektion.
Der Bereich der Behandlung in Krankenhäusern und Kliniken ist wie immer deutlich fehleranfälliger mit 5.259 Fällen (75,91%) im Vergleich zu den niedergelassenen Ärzten mit 1.669 Fällen (24,09%), bei einer Gesamtzahl der Antragsgegner bei Sachentscheidungen von 6.928.
Insgesamt waren die Schlichtungsstellen mit 5.972 Sachentscheidungen betraut, bei 4.114 (68,88 %) der Fälle wurde ein Behandlungsfehler / Risikoaufklärungsmangel bereits dem Grunde nach verneint.
In nur 41 Fällen (0,687%) wurde ausschließlich ein Risikoaufklärungsmangel bejaht. In 1.817 Fällen (30,43 %) wurde ein Behandlungsfehler bejaht. In 359 Fällen (6,01%) wurde ein Behandlungsfehler oder ein Risikoaufklärungsmangel bejaht aber letztlich die Kausalität (Ursächlichkeit des Fehlers für den Gesundheitsschaden) von den Gutachter- und Schlichtungsstellen verneint.
Nur bei ca. 25% der Fälle Arzthaftung dem Grunde nach bejaht
Schließlich sind lediglich 1.499 Fälle zu verzeichnen gewesen, was einer Quote von 25,10 % aller Fälle entspricht, bei denen die Gutachter- und Schlichtungsstellen einen Behandlungsfehler oder Risikoaufklärungsmangel und die Ursächlichkeit des Fehlers für den Gesundheitsschaden (Kausalität) bejaht haben.
Also bei lediglich bei etwa ¼ aller bundesweiten Sachentscheidungen der Schlichtungsstellen ist ein Anspruch des Patienten auf Schadenersatz und Schmerzensgeld dem Grunde nach bejaht worden. Die Anzahl der Sachverhalte, bei denen tatsächlich Zahlungen geleistet wurden, dürfte noch geringer sein, da ein für den Patienten positives Schlichtungsgutachten nicht notwendig bedeutet, dass Klinik oder Arzt bzw. die Haftpflichtversicherung auch Schmerzensgeld oder Schadenersatz zahlen muss.
Oftmals wird jedoch die Bereitschaft bestehen, einen Vergleich zu schließen, wobei es dann auf gute und professionelle Verhandlungsführung auf Patientenseite ankommt, um unter Berücksichtigung aller Schadenspositionen (Schmerzensgeld, Verdienstausfall, Mehraufwendungen, Rentenzahlung, Haushaltsführungsschaden, etc) ein möglichst gutes finanzielles Ergebnis zu erreichen.
In manchen Fällen ist also trotz positivem Schlichtungsgutachten noch ein Zivilprozess vor den ordentlichen Gerichten durchzuführen, wenn die Behandlerseite, meist der Haftpflichtversicherer von Klinik oder Arzt das Gutachten nicht akzeptiert oder die konkrete Höhe der Ansprüche in Euro noch streitig ist.
Man kann es also trotzdem darauf ankommen lassen und abwarten ob der geschädigte Patient tatsächlich willens und in der Lage ist, einen Zivilprozess zu führen. Wenn der Patient dann keine Klage erhebt, geht er in diesen Fällen trotz positivem Schiedsgutachten leer aus.
Lohnt es sich für den Patienten im konkreten Fall einen Antrag zu stellen?
Ob es im Einzelfall lohnenswert erscheint, die Gutachter- und Schlichtungsstellen mit dem eigenen Fall zu betrauen, muss angesichts der doch sehr geringen Erfolgsquoten sehr genau abgewogen und geprüft werden. Die Gutachterverfahren der Schlichtungsstellen sind bei Einverständnis der Gegenseite zwar kostenlos für den Patienten durchführbar, aber leider sind diese auch auch in ca. 75 % der Fälle erfolglos. Existiert erst einmal ein für den Patienten negatives Schlichtungsgutachten, ist ein gerichtliches Vorgehen gegen die Klinik oder den Arzt im Wege des Zivilprozesses weiterhin möglich, aber durchaus erschwert.
Im Zweifel Beratung in Anspruch nehmen
Diese Frage lässt sich nur individuell beantworten. Bevor man als Patient einen Antrag bei einer der Gutachter- und Schlichtungsstellen der Landesärztekammern stellt, empfehlen wir daher unbedingt eine persönliche Beratung durch einen im Medizin- und Arzthaftungsrecht spezialisierten und erfahrenen Rechtsanwalt in Anspruch zu nehmen, auch im Hinblick auf gegebenenfalls bessere Alternativen.
In Fällen des Arzthaftungsrechts ist es von besonderem Vorteil, wenn eine Rechtschutzversicherung abgeschlossen wurde. Diese trägt oftmals die Kosten der Vertretung sowie sämtliche im Prozessfall entstehende Gerichts- und Gutachterkosten für gerichtlich bestellte Sachverständige.
Quelle: Statistische Erhebung der Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen für das Statistikjahr 2018, veröffentlicht am 04.04.2019
Wünschen Sie eine anwaltliche Beratung zum Arzthaftungsrecht?
Rechtsanwalt Matthias Kümpel berät Sie als Spezialist für Arzthaftungsrecht gern und betreibt die Durchsetzung Ihrer Ansprüche.
Telefon: 06021/4229290 oder Kontaktseite.
Sie erhalten schnell eine Antwort. Wir freuen uns Ihre Fragen.